
Arbeitswelt
Wo die Geschenke herkommen
Besuch im riesigen Logistikzentrum von Digitec Galaxus, wo in der Weihnachtszeit buchstäblich die Post abgeht.
Navigation
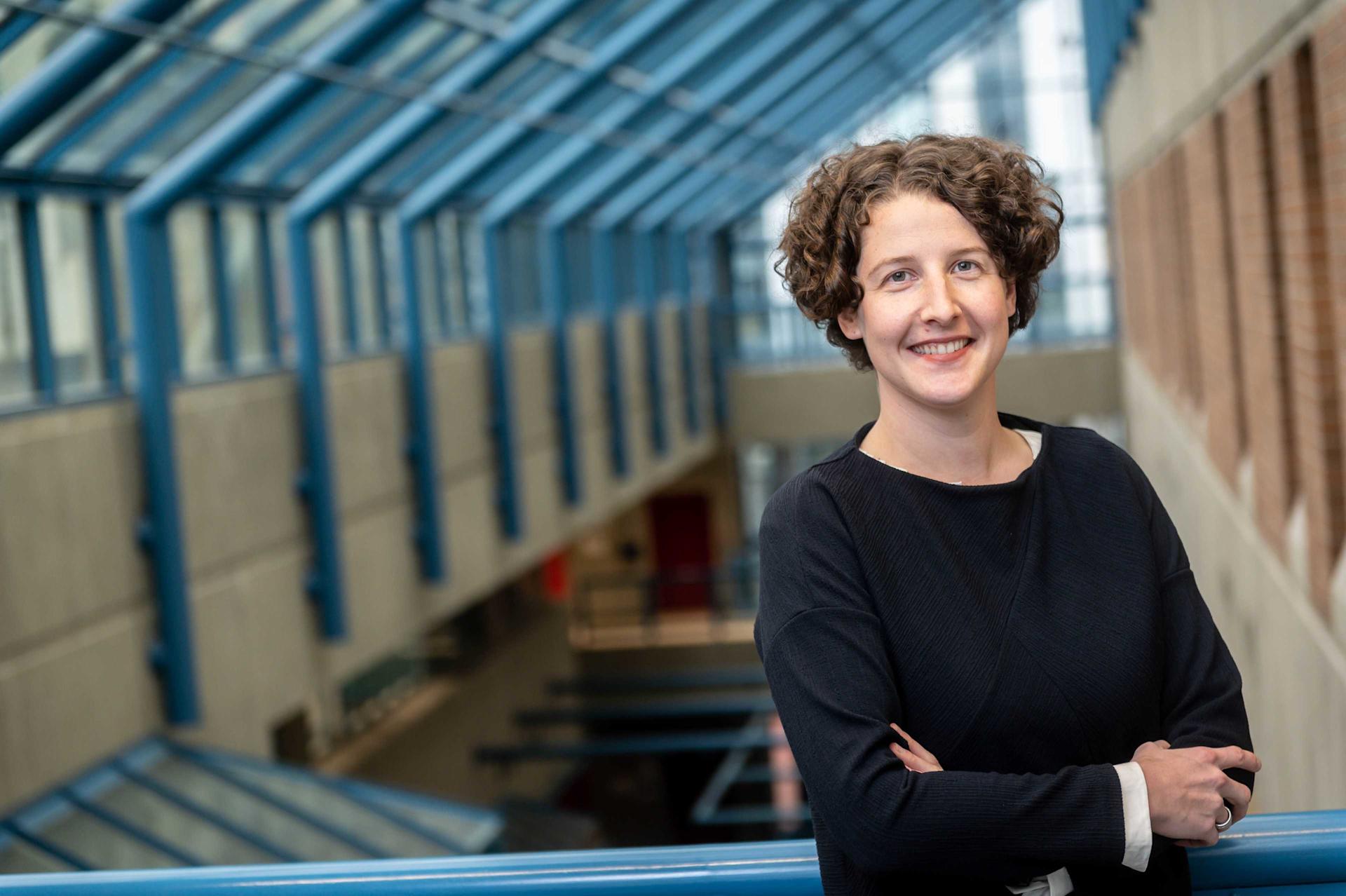
Arbeitswelt
Denkschubladen helfen uns, Menschen schneller einzuschätzen – können aber auch zu unfairen Vorurteilen werden. Was die Psychologie darüber sagt und wie sich die Migros für Chancengleichheit einsetzt.
Die neue Nachbarin aus Italien? – Sicher lebenslustig und laut! Der Mann im Businessanzug? – Reich und zielstrebig!
Denkschubladen oder Klischees sind grobe Kategorien im Kopf, in die wir andere Menschen aufgrund von äusseren Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Hautfarbe oder Aussehen einsortieren. «Dabei betrachten wir einen Menschen als Mitglied einer bestimmten Gruppe und nicht als individuelle Person», erklärt Christa Nater vom Institut für Psychologie der Universität Bern.
Diese starken Verallgemeinerungen werden durch die Sozialisierung, die Medien und unser persönliches Umfeld geprägt und weitergeben.
Weil Denkschubladen dem Gehirn helfen, unsere äusserst komplexe Welt zu vereinfachen und soziale Situationen schneller zu erfassen. Zum Beispiel im Zug, wenn wir uns fragen, ob wir dem wildfremden Sitznachbarn unser Gepäck anvertrauen können.
«Wir schubladisieren, um abzuschätzen, was uns in der Begegnung mit einem anderen Menschen erwartet», sagt Sozialpsychologin Nater. Je weniger wir von unserem Gegenüber wissen, umso einflussreicher sind Denkschubladen.
Kinder lernen früh, Menschen in unterschiedliche Schubladen zu sortieren. Besonders ausgeprägt ist dies bei Geschlechterrollen. Anhand von Alltagsbeobachtungen, Erziehung und kulturellen Einflüssen bilden Kinder bereits im Vorschulalter Vorstellungen (Stereotype) über das Frau- und Mannsein.
Ein Beispiel: Da Frauen viel häufiger lange Haare tragen, verknüpfen Kinder die Haarlänge mit einem bestimmten Geschlecht. Ein Mann mit langen Haaren kann Irritation auslösen.
Beim Heranwachsen sehen Kinder dann, dass Männer öfter in Führungspositionen anzutreffen sind – und verbinden deshalb Eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen eher mit Männern als mit Frauen.
Nein! Vorurteile gehen immer mit einer Bewertung einher, meistens einer negativen, sagt Nater. Dies sei bei Denkschubladen oder Klischees noch nicht der Fall.
Beispiel: Im Tram gibts einen freien Platz neben einer betagten Frau. Die Denkschublade: «Die Frau hört schlecht, ist langsam und mitteilungsbedürftig.» Das Vorurteil: «Die will mich bestimmt in ein nerviges Gespräch verwickeln.»
Durchaus, meint Christa Nater. «Das Körnchen ist gar nicht mal so klein.» Als Beispiel nennt sie das Phänomen, dass Frauen im Vergleich zu Männern öfter mit sozialen Kompetenzen verbunden werden: Sie gelten als fürsorglicher und mitfühlender. «Tatsächlich beschreiben sich viele Frauen genauso», sagt Nater.
Gefestigt werde das Klischee dadurch, dass immer noch überwiegend Frauen Care-Arbeit wie Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen leisteten. Männer hingegen gelten als durchsetzungsstark, mutig, ambitioniert, weil diese Fähigkeiten in Führungspositionen gefordert sind, wo weiterhin mehrheitlich Männer arbeiten – ein sich selbst verstärkender Kreislauf.
So ist es in der Schweiz heute noch immer der Fall, dass Mädchen seltener technische und naturwissenschaftliche Berufe wählen, Buben dagegen seltener in Care-Berufe gehen.
Wenn die Bilder in unserem Kopf dazu führen, dass wir andere Menschen automatisch benachteiligen – etwa in der Arbeitswelt: «Experimentelle Studien haben gezeigt, dass ein ‹Martin› häufiger zu Bewerbungsgesprächen für eine Führungsposition eingeladen wird als eine ‹Martina› mit denselben Qualifikationen», sagt Nater.
Zudem haben es Menschen mit ausländisch klingendem Namen schwerer, den Zuschlag für eine Wohnung zu erhalten. «Es ist wichtig, Klischees zu hinterfragen, um ungleiche Chancen zu bekämpfen.»
In einer Gesellschaft, die Fairness und Chancengleichheit anstrebt, dürfen Menschen nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, Religion oder Herkunft systematisch benachteiligt werden.
Indem wir uns unserer Denkschubladen bewusst werden. Wir können uns antrainieren, bei neuen Begegnungen immer kurz innezuhalten und unser spontanes Urteil über einen Menschen zu hinterfragen: «Habe ich wirklich genug Informationen über diese Person, um sie angemessen und unvoreingenommen zu beurteilen?»
Vor allem in Stresssituationen oder bei Zeitdruck sollten wir die Entscheidungsfindung verlangsamen – denn hier haben Denkschubladen und Vorurteile leichtes Spiel, wie Christa Nater betont.
Wer sich auf neue Erfahrungen einlässt und den Kontakt zu Menschen aus anderen sozialen Gruppen sucht, trainiert ein offeneres Denken.
Ob am Schreibtisch, in einer Filiale oder im Labor – unsere Arbeitswelt ist vielfältig. Genauso wie die Menschen dahinter. Entdecke ihre Geschichten.